Der zehnjährige Sidney Wilks stocherte mit einem Stock in einem Ameisenhaufen, einfach um zu sehen, ob er die Insekten auseinandertreiben könnte. Er trieb die Spitze seines vorgetäuschten Schwerts in eine der großen Ameisen hinein und grinste. Das war zwar nicht besonders nett, aber im Moment fühlte er sich auch nicht nett.
Die Eingangstüre öffnete sich und Sidneys Vater Jackson trat auf die Veranda. „Komm aus dem Dreck raus.“
„Ja.“ Sidney stand auf, dann wischte er sich den Staub von der Hose.
„Wenn du hier draußen bleibst, dann setz dich auf die Terrasse“, befahl Jackson.
„Ja.” Sidney setzte sich an den Rand der Veranda und ließ seine Füße über die Seite baumeln. In Wilks Haus waren gute Manieren vorgeschrieben, aber im Geist war Sidney damit beschäftigt, seinem Paps die Meinung zu sagen. Manchmal wünschte er sich, dass ein großer fetter Käfer seinem Vater die Nase hochkriechen würde. Diese Vorstellung brachte ihn beinahe zum Kichern. Beinahe.
Wenn er schon einen Elternteil wegen Krebs verlieren musste, hätte es dann nicht wenigstens sein Vater sein können? Doch, das war ein abscheulicher Gedanke, aber Sidney war mit seinem Vater noch nie gut ausgekommen. Seine Mutter andererseits war sein Ein und Alles gewesen.
Elisabeth Running Elk-Wilks war eine der stärksten Menschen, die er je gekannt hatte. Sie war wie eine Superheldin. Nicht, weil sie ein Cape oder Ähnliches trug. Ach was, meistens hatte sie ein großes Karohemd angehabt und einen Schlapphut aus Leder, den sie Old Ben nannte.
Sidney hatte geglaubt, seine Mama wäre unzerstörbar. „Verdammter Krebs“, fluchte er. Bevor ihr sowieso schon magerer Körper vom Eierstockkrebs komplett verwüstet wurde, hatte Beth Seite an Seite mit den Männern der Running-E-Ranch gearbeitet. Um vier Uhr früh stand sie auf und ging viel später als Sidney ins Bett. Irgendwie hatte sie es in der Zeit dazwischen geschafft, ihrem Sohn das Gefühl zu geben, als wäre er ein so außergewöhnlicher Junge, wie es ihn auf der ganzen Welt nur einmal gab.
Sidney stieß mit den Fersen gegen das Holzgeländer, das rund um die Veranda führte. Jetzt gab es sie nicht mehr und er wusste, dass er nie wieder jemand Besonderes sein würde, vor allem nicht für seinen Vater. Seinem Vater gelang es immer, ihm das Gefühl zu vermitteln, als wäre er eine Enttäuschung. Seine Mama hatte verstanden, dass er nicht dazu bestimmt war, Rancher zu werden, aber sein Vater hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Es war nicht so, als ob sein Vater durch und durch gemein war. Er war einfach nur … hart zu ihm. Sidney nahm an, sein Vater dachte, dass ihn das zäh oder irgendetwas in der Art machen würde. Er schnaubte vor sich hin. Auch mit zehn wusste er schon, dass er nie so wie sein Paps sein würde.
Er legte sich auf der Terrasse auf den Rücken, die gefalteten Händen unter seinem Kopf. Er starrte hinauf an die hellblau gestrichene Decke und überlegte, was die Kinder in der Schule wohl sagen würden, wenn er zurückkam. Sein Vater hatte ihn die vergangene Woche zu Hause bleiben lassen. Es gab Dinge zu erledigen, hatte Paps gesagt. Sidney wusste jedoch immer noch nicht, was das für Dinge waren. Der einzige Job, den man ihm gegeben hatte war, die Kleider seiner Mutter wegzupacken. Er verstand immer noch nicht, warum er das so bald nach ihrem Tod hatte tun müssen.
Wenn er jetzt darüber nachdachte, dann war Sidney eigentlich froh, dass ihm diese Aufgabe zugeteilt worden war. Dadurch hatte er die Gelegenheit gehabt, ein paar Kleidungstücke seiner Mutter zu behalten. Er hatte nicht viele Sachen aufgehoben, aber ein paar Dinge hatte er hinten in seinem Schrank versteckt.
Sidney hörte, wie die Tür mit dem Fliegengitter zuschlug und legte den Kopf in den Nacken. Er sah Mrs. O’Dwyer. Es schien, als stünde sie auf dem Kopf. Komisch.
„Sidney, magst du vielleicht einen Teller mit feinen Sachen zum Essen?“
„Nein, danke.“ Bei ihm zu Hause hielten sich einfach zu viele Leute auf. Sie schienen alle zu denken, dass es sich mit einem Stück Kuchen oder einer Hähnchenkeule besser anfühlen würde, wenn seine Mama unter der Erde lag. Sie waren ein Haufen Idioten.
Mrs. O’Dwyer gab einen Schnalzlaut von sich und ging wieder ins Haus zurück zu den anderen Erwachsenen. Sidneys Vater hatte ihm erzählt, dass es viel über seine Mutter aussagte, wenn ihr so viele Leute nach dem Begräbnis ihre Aufwartung machten. Sidney war unklar, was das heißen sollte. Vielleicht waren die Restaurants in der Stadt geschlossen, weil alle, die kamen, scheinbar Hunger hatten.
Sidney rollte sich auf die Seite. Er wusste, dass sein Anzug ganz schmutzig werden würde, aber er bezweifelte, dass er ihn je wieder tragen würde. Er bemerkte eine kleine Blase grauer Farbe auf dem alten Holzboden. Er streckte die Hand danach aus und rieb mit seinem kurzen Fingernagel über die Blase, bis sie aufplatzte und das verwitterte Holz freilag. Er überlegte, wie alt das Holz wohl war. Hatte sein Opa, Harry Running-Elk (Rennender Elch, Anm. d. Übers.), es eingebaut?
„Ich wünschte, du wärst da, Opa“, flüsterte er.
Eine Träne lief ihm über die Nase und fiel auf die Veranda. Er wischte sich mit dem Jackenärmel schnell über die Augen, bevor er sich umsah; er wollte sichergehen, dass niemand da war. Es wohnten ziemlich viele Cowboys auf der Ranch und das letzte, was Sidney wollte war, dass es jemand seinem Paps erzählte.
Während er weiter an der Farbe herumzupfte erinnerte er sich an die Abreibung, die er vor ein paar Jahren bekommen hatte, als ihn sein Vater beim Weinen erwischte. Farmvieh war laut seinem Vater auch nichts anderes als Nutzpflanzen. Sidney hatte den Fehler gemacht, ein Kälbchen liebzugewinnen. Die Mutter des kleinen roten Kalbs hatte sich geweigert, es zu säugen, also war es Sidneys Aufgabe gewesen, den Kleinen mit der Flasche zu füttern. Seine Mama hatte ihn gewarnt, dass er es nicht zu gernhaben sollte, aber er hatte nicht auf sie gehört. Er war sogar so weit gegangen, ihm einen Namen zu geben, Archie, nach einer seiner Lieblings-Comicfiguren.
Er konnte sich noch daran erinnern, wie er eines Tages nach der Schule in den Stall gerannt war und die speziell von ihm hergerichtete Box war leer gewesen. Erfolglos hatte er auf der Weide gleich neben dem Stall nachgesehen, dann hatte Sidney seine Mutter gesucht.
Als er hörte, dass sein geliebter Archie zur örtlichen Viehauktion geschafft worden war, hatte der achtjährige Sidney die Arme um seine Mutter geworfen und war in Tränen ausgebrochen. Während seine Mutter ihm noch tröstende Worte zuflüsterte, war sein Paps in Haus gekommen. Er hatte Sidney sofort befohlen, seine Augen zu trocknen, wieder in den Stall zu gehen und mit seinen abendlichen Pflichten anzufangen.
Wenn es nur dabei geblieben wäre, dachte Sidney und schnipste mit dem Finger Farbflocken weg. Sein Vater war ihm in den Stall gefolgt und hatte ihn angebrüllt, er sei ein Muttersöhnchen. Er hatte Sidney gesagt, dass richtige Männer nicht weinen, besonders nicht wegen so einer Dummheit wie einem blöden Kalb. Die Lektion hatte eine Stunde gedauert und handelte davon, was es bedeutete, Rancher zu sein. Das war der Moment, in dem Sidney beschlossen hatte, dass er mit dem Beruf Rancher nichts zu tun haben wollte.
Er hörte Stiefelabsätze auf den Stufen, setzte sich schnell auf und blinzelte die letzten Tränenreste weg. Grady Nash, der neueste Cowboy auf der Ranch, kam auf Sidney zu. Er versuchte, die beschädigte Stelle der Veranda mit seiner Hand zu verdecken.
Nash überraschte ihn, als er sich einen Meter weit weg in den Schaukelstuhl setzte. „Tut mir leid mit deiner Mutter.“
„Ja, mir auch.“ Als klar wurde, dass Nash offenbar nicht gekommen war, um ihn anzuschreien, nahm Sidney wieder seine liegende Position ein. Er richtete seine Aufmerksamkeit erneut auf die Stelle mit dem Holz, das er bloßgelegt hatte. „Was meinst du, wie alt diese Bretter sind?“
„Keine Ahnung“, antwortete Nash. „Ich glaube, viel älter als wir beide.”
„Ja.” Sidney schälte sorgfältig einen dicken Batzen Farbe von der Größe eines Vierteldollars ab. Er hob ihn hoch, starrte ihn ein paar Sekunden lang an und schnipste ihn dann auf den vorderen Teil der Veranda. Er war nicht sicher, wie alt Nash war, aber er hatte gehört, wie der Cowboy seinem Vater erzählte, dass nicht plante, aufs College zu gehen, also schätzte ihn Sidney auf etwa 18 Jahre.
Sidney sah zu Nash hinüber, der scheinbar damit beschäftigt war, mit seinem Taschenmesser aus einem Stück Holz ein Tier zu schnitzen. Er überlegte, ob Nash wohl schon gegessen hatte. Sollte er ihm vielleicht von dem ganzen Essen erzählen, das es im Haus gab?
Er beschloss, nichts zu sagen und fuhr fort, die Veranda freizulegen. Sidney hatte gemerkt, dass Nash nicht viel mit Leuten redete, daher nahm er an, dass der Cowboy ihm sehr ähnlich war. Es war nicht so, als ob Sidney nichts zu sagen hatte, aber er war noch niemandem begegnet, der sich für die Sachen interessierte, die er mochte.
Ein paar Stunden vergingen, bevor der letzte hungrige Gast gegangen war und die Sonne hinter dem Hügel versank. Eine Berührung an der Schulter weckte Sidneys Aufmerksamkeit. Er rollte sich auf den Rücken und starrte zu Nash auf, sein Blick heftete sich auf dessen lange Koteletten. War Nash nicht zu jung, um so viele Haare im Gesicht zu tragen?
Wortlos gab Nash Sidney das Stück Holz, an dem er den ganzen Nachmittag geschnitzt hatte. „Ein Hirsch?“
„Antilope“, korrigierte Nash. „Es ist ein Totem. Wenn du willst, sag deinem Paps, er soll dir ein Stück Sandpapier geben, um die rauen Ecken abzuschmirgeln.“
Sidney setzte sich auf und ließ einen Finger über das spitze Gehörn der Antilope gleiten. „Kennst du dich aus mit Totems?“
Nash lächelte zum ersten Mal, seit er auf die Veranda gekommen war. „Als ich erfahren habe, dass deine Mama eine Cherokee war, habe ich mir ein Buch aus der Bibliothek geholt.“ Er zuckte mit den Achseln. „Es interessiert mich.“
Sidney hatte von ihnen gehört, aber noch nie, dass jemand eine Antilope als Totem hatte. „Was bedeutet es?“ fragte er und hielt das Schnitzwerk hoch.
„Schlag es nach.“ Nash tippte sich an den Hut und ließ Sidney auf der Veranda sitzen.
Als er sein Totem anstarrte, fiel ihm die beschädigte Veranda ein. Sidney biss sich auf die Unterlippe. Was vorhin vielleicht ein netter Einfall gewesen war, entpuppte sich jetzt als furchtbar. „Paps wird mich umbringen.“
Er starrte immer noch auf den Boden, da hörte er Nashs Stimme und fuhr zusammen.
„Geh wieder rein, bevor dein Paps herauskommt und nach dir sucht. Ich bringe das in Ordnung.“
Jetzt bemerkte Sidney die Farbdose in Nashs Hand. Graue Tropfen auf ihrer Seite verrieten ihm, dass Nash plante, Sidneys beschädigte Stellen zu übermalen. Er stand auf, klopfte sich die Hose ab und merkte, dass es nichts helfen würde, egal wie gründlich er sie abwischte. Vielleicht würde sein Paps nichts merken? Er war ja in den letzten Stunden nicht mal herausgekommen, um nach ihm zu sehen. Sidney fragte sich, ob sich sein Paps überhaupt noch erinnerte, einen Sohn zu haben.
Nash öffnete die Farbdose. Er benutzte den Stock, mit dem Sidney vorher gespielt hatte, um die dicke graue Flüssigkeit umzurühren.
„Danke, Grady”, sagte Sidney und steckte das Totem ein.
„Unser Geheimnis.“ Nash legte den Finger an die Lippen. „Und nenn mich Nash. Mein Vater hieß Grady“, sagte er und tippte an seinen Hut.
Sidney lächelte, bevor er in das stille Haus hineinging. Die Lichter im Wohnzimmer waren eingeschaltet, aber es schien niemand da zu sein. Er fand seinen Vater am Küchentisch, umgeben von Stapeln halb gegessener Aufläufe.
Sidney trat einen Schritt zurück und schlang die Arme um sich selbst. Es war das erste Mal, dass er seinen Vater weinen sah und es machte ihm Angst. Seine Augen fingen zu brennen an, als das Schluchzen seines Vaters zunahm. Sidney sah sich um und war unsicher, was er tun sollte. Er ging rückwärts aus dem Zimmer und zurück auf die vordere Terrasse.
Nash beendete gerade seine kleine Malerarbeit. Er sah hoch, als Sidney auf die Veranda kam. „Was ist denn los?“
Sidney zeigte auf das Haus. „Mein Paps. Er .. äh.” Sidney schüttelte den Kopf. „Er weint und ich weiß nicht, was ich tun soll.“
Nash drückte den Deckel wieder auf die Farbdose und legte den Pinsel darüber. „Ich bin sicher, er ist einfach nur traurig. Vielleicht möchte er umarmt werden?“
„Nein“, sagte Sidney schnell. „Sowas mag er nicht.“
Nash starrte Sidney ein paar Sekunden lang an. „Dann ist es wahrscheinlich das Beste, wenn man ihn jetzt alleine lässt. Jeder trauert auf eine andere Weise. Es gibt Leute, die lassen alles auf einmal aus sich heraus und dann haben sie es hinter sich.“
Sidney wusste, dass Nashs Vater im vergangenen Winter gestorben war. Es hatte sogar in der Zeitung gestanden. Grady Nash Senior war Polizist in der Stadt Bridgewater gewesen, nur ein paar Kilometer weit weg. Nash, stellvertretender Sheriff, hatte versucht, einer Frau zu helfen, deren Auto im Schnee festsaß, ein anderes Auto war über ein vereistes Straßenstück gerutscht und hatte ihn überfahren und getötet.
„Wie lange tut es weh?“, fragte Sidney. Zum ersten Mal seit langer Zeit ließ er seinen Tränen freien Lauf, ohne sie wegzuwischen.
Nash setzte sich auf den Stuhl, auf dem er den ganzen Nachmittag gesessen hatte und zog Sidney in seine Arme. „Ich weiß es nicht, aber wenn ich es herausfinde, dann sag ich dir Bescheid.“
Sidney wehrte sich zuerst gegen die Umarmung. Es fühlte sich seltsam an, wenn ihn eine andere Person als seine Mutter so hielt.
„Ist schon in Ordnung“, sagte Nash beruhigend und klopfte Sidney auf den Rücken. „Es ist nichts dabei, wenn man weint.“
Sidney entspannte sich ein bisschen. „Mein Vater mag das nicht.“
„Naja, dein Vater hat gerade eigene Probleme, also kann es unser Geheimnis bleiben.“
Sidney nickte nochmal, und dann ließ er die Umarmung zu. Er wusste noch nicht, wie er mit dem Schmerz in seinem Herzen leben könnte, aber im diesem Moment fühlte er sich besser an.

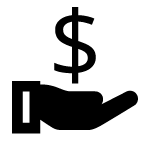
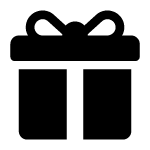
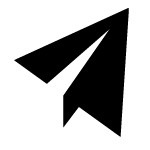
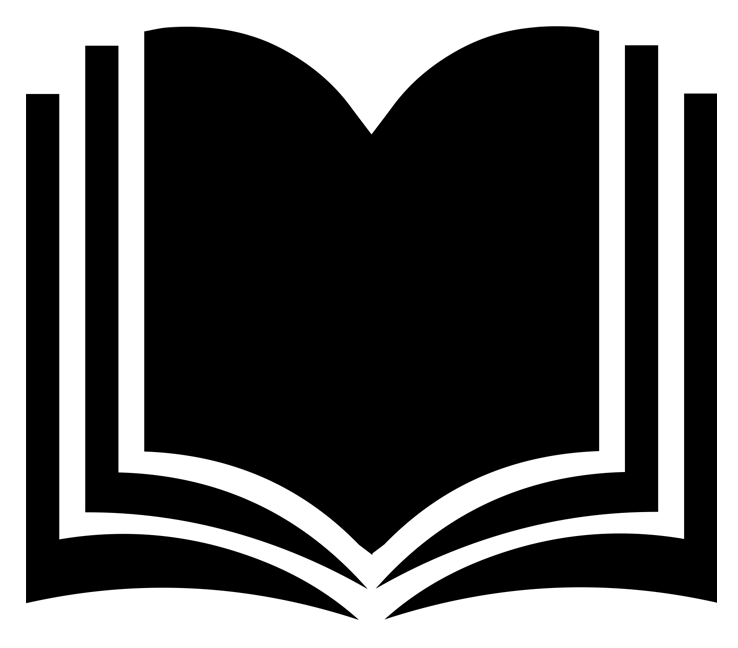



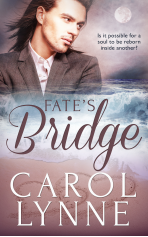
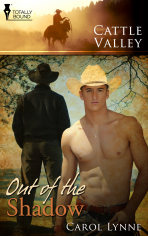

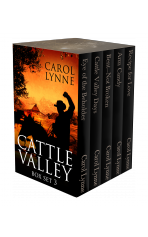


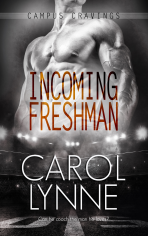

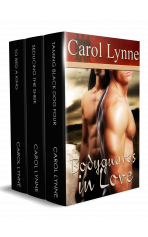


 Facebook
Facebook Twitter
Twitter